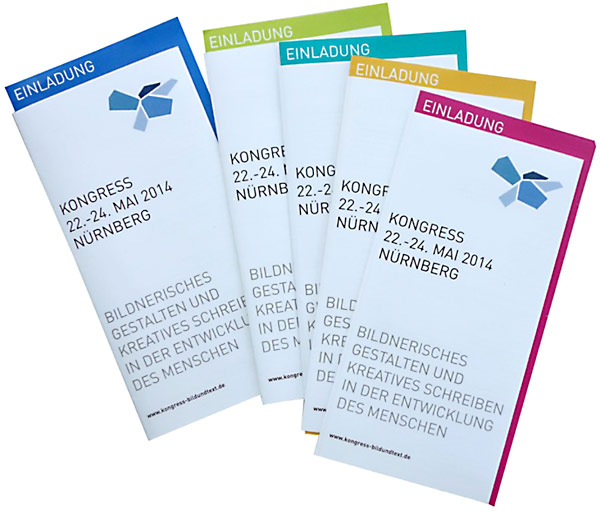Welche Rolle spielen (neue) Medien in Schule, Hochschule und Beruf? Wie verändern sie unsere Kommunikationspraktiken, insbesondere das Schreiben und Lesen von Texten? Welcher Art sollten methodisch-didaktische Konzepte sein, um Lernende in der kompetenten Nutzung der neuen Medien zu unterstützen?
Diese und andere Fragen diskutierte das VIII. Prowitec Symposium in Gießen. Das diesjährige Symposium legte damit einen besonderen Schwerpunkt auf die Frage medienspezifischer Schreibprozesse, die es anhand der Ausbildungslinien (Schule, Hochschule, Beruf) nachvollzog. Die Diskussion, so zeigte Programm wie Teilnehmerfeld, verlangt eine ebenso interdisziplinäre (Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Erziehungswissenschaften, Mediendidaktik) wie internationale (Vortragende und Zuhörende kamen aus Deutschland, Dänemark, Italien, Österreich und der Schweiz) Perspektive. Neue Medien wirken global(isierend). Wie, wozu und in welcher Qualität die Nutzung erfolgt, ist empirisch, besonders aber theoretisch wie didaktisch noch weitgehend Forschungsdesiderat. Erhebungen zur Zielgruppe wie statistische Befunde geben nur unzureichend Auskunft über die sich dahinter verborgenen Prozesse.
Das Symposium wurde durch einen Vortrag der Veranstalterinnen eröffnet. Katrin Lehnen (Gießen), Kirsten Schindler (Köln) und Eva-Maria Jakobs (Aachen) stellten eine exemplarische Bestandsaufnahme der drei Domänen, Schule, Hochschule, Beruf vor. Lehnen konstatiert eine zunehmende Auseinandersetzung zum Themenbereich ‚Schule und neue Medien’, problematisiert gleichzeitig den zum Teil unklar gebrauchten Medienbegriff wie die undifferenzierten mediendidaktischen Konzepte. Zur Aufbereitung des Feldes schlägt sie ein dreidimensionales Modell vor, das zwischen computergestützter Textproduktion, Schreiben in neuen Medien und E-Learning unterscheidet. Im ersten Bereich wirken neue Medien als Schreibmedium (z. B.Tastatur), im zweiten als Kommunikationsmedium, im dritten schließlich als Lernmedium. Schindler zeigt, wie vielfältig neue Medien inzwischen den Hochschulalltag prägen. Neue Medien werden zur Unterstützung von Service, Verwaltungs- und im weitesten Sinne Dienstleistungsaufgaben eingesetzt, sie fungieren als Element der PR, sie ermöglichen neuartige Forschungstätigkeiten (beispielsweise durch Online Zeitungen wie die „Zeitschrift Schreiben“ und Forschungsplattformen wie das „ipTS Interdisziplinäres Portal Textproduktion und Schreiben“) und sie werden in der Lehre eingesetzt. Mit der Nutzung solcher Lernplattformen sind technische, juristische, aber vor allem auch methodisch-didaktische Fragen verknüpft, zu denen bislang noch wenig Antworten vorliegen. Jakobs stellt anschaulich vor, in welcher Geschwindigkeit neue Medien in den Berufsalltag eingedrungen sind und in welcher Ausdifferenziertheit sie eingesetzt werden. Unternehmen operieren inzwischen mit verschiedenen medialen Gattungen gleichzeitig, die sie gezielt für unternehmerische Belange einsetzen, z.B. Blog, Forum, E-Mail, Webseite, Newsletter etc. Am Beispiel der Altenpflege zeigt sie, wie sich durch neue Medien wie auch die Pflicht zur Dokumentation berufliche (Schreib-)Anforderungen verändern. Ausbildung wie Forschung bieten bislang kaum überzeugende Konzepte zur Unterstützung dieser medialen Schreibkompetenten an.
Daniel Perrin (Winterthur) akzentuiert in seinem Vortrag eine zentrale ‚Neuigkeit’ der neuen Medien. Neu sei, dass ein Text in sehr unterschiedlichen Ausgabeformaten repräsentiert sein könne (das bezieht sich auf die Größe des Ausgabegeräts, Handy, Bildschirm etc., wie auch auf die weitere Verwendung des Textes) und in all diesen Formaten funktional sein müsse. Neue Medien – und das hat einerseits theoretische Konsequenzen – verändern also unseren Begriff der Einheitlichkeit von Text und Format, so wie er noch den alten Printmedien (Zeitungen, Buch) zugrunde lag. Neue Medien bedingen aber auch andere Schreibkompetenzen für die in seinem Vortrag diskutierte Gruppe der Berufsjournalisten. Ein Journalist müsse in mehreren Formaten kompetent sein oder sich durch Formen kollaborativen Schreibens Expertise aneignen.
An diese beiden Überblicksvorträge anknüpfend fokussierte der erste thematische Strang den Bereich „Schule“. Olaf Gätje (Gießen) breitet am Beispiel der Bildungsstandards Deutsch das bereits von Lehnen akzentuierte Problem des inkonsequenten Medienbegriffs aus. Unter dem Stichwort ‚Medien’ fänden sich sehr unterschiedliche Zuschreibungen. In der engen Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung Hessen (Gätje/Lehnen) sei die Schwierigkeit der konsistenten, widerspruchsfreien und (auch Moden) überdauernden begrifflichen Schärfung aber auch ganz praktisch als Problem erkannt geworden. Ulla Kleinberger (Winterthur) und Franc Wagner (Zürich) stellen empirische Befunde aus unterschiedlichen Studien zum Schreiben von Schülerinnen und Schülern in neuen Medien vor. Sie zeichnen dafür einen weiten Bogen des Einsatzes von neuen Medien in der Vorschule bis zur Sekundarstufe II. Neue Medien können, so ein Fazit, Schreibmotivation wie auch Schreibkompetenz fördern. Dass sie zum Verfall der Schriftkultur beitragen, beispielsweise in der übermäßigen Nutzung von Emoticons, sei eine Legende, die sich durch empirische Belege nicht erhärten lässt. Christine Trepkau (Flensburg) stellt ein konkretes Projekt vor, in dem WebQuests für den Deutschunterricht genutzt werden. Es reicht nicht, so stellt die Vortragende eindringlich dar, das technische Instrumentarium verfügbar zu machen, es bedarf einer methodischen Aufbereitung, klarer Schreibanweisungen und entsprechender Hilfsangebote, damit die Schülerinnen und Schüler auch davon profitieren könnten. Karin Tschakert (Berlin) verbindet die Überlegungen zur Prozessorientierung einerseits mit neuen Medien andererseits, hier im Sinne eines Schreibmediums, und prüft in ihrem experimentellen Setting, ob und entsprechend wie sich die Schreibleistung verändert. Ihr erster Schluss aus den Befunden: Neue Schreibmedien unterstützen die Prozessorientierung beim Schreiben und tragen so zur Schreibkompetenz bei.
Michael Beißwenger (Dortmund) bezieht sich in seinem Vortrag auf den Umgang mit Wikis im Ausbildungskontext Hochschule, mit denen er insbesondere kollaborative Schreibprozesse anleitet. Wikis eignen sich dank der schnellen Einarbeitung und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auch für die Schule. Synergieeffekte lassen sich insbesondere in der Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, (Deutsch-)Lehrerinnen und Lehrern, erzielen. Odile Endres (Greifswald) nutzt ebenfalls Wikis für ihre Hochschullehre und stellt ein ausgewähltes Lehrprojekt vor. Studierende entwickeln kooperativ und in eigenem Projektmanagement einen virtuellen Stadtführer für die Stadt Greifswald. Helmuth Feilke, Martin Steinseifer und Katrin Lehnen (Gießen) stellen eine in der Entwicklung befindende elektronische Schreibumgebung vor, die zum einen Studierende im wissenschaftlichen Schreiben unterstützt, zum anderen Schreibprozesse für eine systematische Analyse aufzeichnet. Ziel ist die Ausbildung zur Kontroversefähigkeit, die als zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Schreibkompetenz identifiziert wurde. Melanie Brinkschulte (Göttingen) zeigt an Beispielen, wie sich Schreibpartnerschaften zwischen Mutter- und Fremdsprachenlernenden elektronisch anbahnen und institutionell verankern lassen. Schreiben in einer elektronischen Umgebung wird hier sowohl zum Kommunikationsmedium als auch zum Lernmedium: dem Erlernen der fremden Sprache und ihrer (wissenschaftlichen) Schreibkonventionen. Doris Fetscher (Zwickau) eröffnet mit ihren Überlegungen zum interkulturellen Schreiben in neuen Medien einen bislang weniger diskutierten Bereich des Nutzungseinsatzes. Neue Medien, hier Forendiskussionen von Teilnehmenden eines Kurses zum Thema „Interkulturalität“ an der Universität Zwickau, dokumentieren Schreibhandlungen. Forschungsdaten ergeben sich hier als natürliches ‚Abfallprodukt’ aus den eines schriftlichen Mediums geschuldeten Aushandlungsprozessen.
Mit dem Vortrag von Annette Verhein (Rapperswil) und Bruno Frischherz (Zürich) wurde das dritte Panel, „Beruf“, eröffnet. Die Vortragenden betonen den insbesondere für die neuen Medien relevanten Aspekt der (schriftlichen) Kollaboration. Texte für neue Medien entstehen im Zusammenspiel verschiedener Akteure, die sich entsprechend koordinieren, Zeitpläne, Organisationsrahmen und Textkriterien aufstellen müssen. Sie konkretisieren diesen Aspekt der Schreib-/Medienkompetenz in der Anleitung von (angehenden) Ingenieuren. Carmen Heine (Aarhus) stellt ihr kürzlich veröffentlichtes Modell zur Produktion von Online-Hilfen dar. Online-Hilfen sind eine inzwischen etablierte Textsorte, die Softwareprodukte begleiten und funktional wie formal beschreibbar sind. Auf der Basis von Schreibprozessdaten leitet die Vortragende Hinweise zur Produktion dieser Hilfstexte ab, diese Hinweise werden inzwischen auch in der Praxis genutzt. Johannes Dreikorn (Erlangen) schließt die Tagung mit seinem Vortrag zur Frage der Modularisierung von Schreibprozessen. Seine empirisch erhärtete These: Modularisierung von Schreibprozessen, so wie sie in der technischen Dokumentation zur Entlastung von Redakteuren, Übersetzern und Kostenstellen eingesetzt werden, könne zu unverständlichen und wenig authentischen Texten führen. Neben der Modularisierung als Form der elektronisch unterstützten Standardisierung von Arbeits-/Schreibprozessen bedarf es ebenfalls der individuellen Auseinandersetzung mit Schreibaufgaben.
Neben den beschriebenen Leerstellen in der theoretisch wie methodisch-didaktischen Auseinandersetzung zeigte das Symposium auch ein lebendiges und diskussionsoffenes Forschungsfeld. Gleichwohl zeigte das Symposium auch, dass es engerer Vernetzung der unterschiedlichen Akteure bedarf, um die Diskussion zu etablieren. Einrichtungen wie der prowitec e.V., der neben dem Zentrum für Medien und Interaktivität der JLU Gießen Hauptsponsor des Symposiums war, können neben den regelmäßigen Tagungen ein solches Forum bieten (http://www.prowitec.rwth-aachen.de/prowitec-ev/). Das nächste Symposium wird im Juni 2011 in Rapperswil (Schweiz) unter der Leitung von Annette Verhein stattfinden. Die Tagungsergebnisse des Giessener Symposiums werden im Peter Lang Verlag veröffentlicht und erscheinen im Herbst 2010.